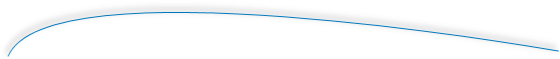Spaziergänge durch poetische Wälder
Zum Wortschatz der Poeten
von Lessing bis Heym
von Lessing bis Heym
Erster Spaziergang
1. Brotlose Kunst
Gedichte? Gedichte sind etwas für Frauen, sagte mir ein Bekannter, als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, durch poetische Wälder zu spazieren. Dann sind, so dachte ich unwillkürlich, wohl Romane etwas für Männer und - der Ausgewogenheit zuliebe, Dramen für beide Geschlechter, denn ins Theater geht man nicht gern alleine. Aber seltsam, ging es mir weiter durch den Kopf, es sind meistens Männer, die Gedichte schreiben, zumindest die Gedichte, die Eingang in jene ominöse Sammlung von Werken fanden, die man Kanon nennt. Sollte es sich mit der Dichtkunst ähnlich wie mit der Kochkunst verhalten? Die meisten Berufsköche (ausgestattet mit unterschiedlichen Qualitätssternen) sind Männer, zuhause aber kochen (zumindest in der Vergangenheit) meist die Frauen, die züchtige Hausfrau, wie der Klassiker Schiller sie nannte.
Gedichte? Gedichte sind ja out, teilte ein Student der Literaturwissenschaft einer rheinischen Universität einem Dozenten mit, der ein Seminar über ein lyrisches Thema veranstaltete und das Wunderliche, um nicht zu sagen Wunderbare, an der Aussage war, daß sich niemand der Anwesenden darüber wunderte, auch der Dozent nicht.
Gedichte? Gedichte im Land der Dichter und Denker? Kaum vorstellbar, daß sich im Jahre 2012 zwei Arbeiter in der Frühstückspause über Brechts Gedicht: Fragen eines lesenden Arbeiters unterhalten, oder daß ein Politiker seine Ablehnung eines Kriegseinsatzes mit Trakls Grodek untermauerte.
Diese “feminine Nichtigkeit” (um die beiden zeitgenössischen Auffassungen in einer Metapher zu vereinigen) hat offenbar heute keinen großen Stellenwert in der Gesellschaft; ja, so könnte man meinen, wäre da nicht das Bildungsinstitut Schule, dann nähme man die Existenz dieser fragilen, oft nur aus wenigen Wörtern bestehenden sprachlichen Gebilde überhaupt nicht mehr wahr.
Sind Gedichte also nur die Mauerblümchen des “Kulturlebens” (die Anführungszeichen stehen nicht aus Versehen), das sich allenfalls ein wenig verschämt in der Ecke einer Feuilleton-Seite den Blicken der (literarischen) Öffentlichkeit zeigen darf?
Aber steht es wirklich so schlecht um diese harmlosen Produkte poetischer Einbildungskraft (oder auch Einbildungsschwäche)? Gewiß, die Zahl der Leser ist so überschaubar wie die Zahl der Zuschauer bei einem Fußballspiel der Kreisklasse, aber die Zahl der Dichter?
Niemand weiß, wie viele Gedichte je gedichtet wurden; sie wurden mündlich weitergegeben, in Stein gemeißelt, auf Pergament, Papyrus und Papier geschrieben; sie wurden veröffentlicht und nicht veröffentlicht (vermutlich die Mehrzahl) und heute, im 21. Jahrhundert, schwimmen nicht wenige von ihnen in den Weiten der virtuellen Netz-Welt, eine Art von digitaler Flaschenpost, die irgendwann auf dem Bildschirm eines potentiellen Lesers landet. Zahlreiche Töchter und Söhne der Muse Euterpe schicken so ihre hoffnungsvollen Botschaften in eine amusische Welt, deren Insassen sich selten geneigt zeigen, sie auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Brotlose Kunst? Noch schlimmer, wie Heinrich Heine in einem Sonett behauptet und sich - vermutlich vor Hunger - nicht scheut, gegen die Grammatik brotlos noch zu steigern:
Burleskes Sonett
Wie nähm die Armut bald bei mir ein Ende,
Wüßt ich den Pinsel kunstgerecht zu führen
Und hübsch mit bunten Bildern zu verzieren
Der Kirchen und der Schlösser stolze Wände.
Wie flösse bald mir zu des Goldes Spende,
Wüßt ich auf Flöten, Geigen und Klavieren
So rührend und so fein zu musizieren,
Daß Herrn und Damen klatschten in die Hände.
Doch ach! Mir Armen lächelt Mammon nie:
Denn leider, leider! Trieb ich dich alleine,
Brotloseste der Künste, Poesie!
Und ach! Wenn andre sich mit vollen Humpen
Zum Gotte trinken in Champagnerweine,
Dann muß ich dürsten, oder ich muß - pumpen.
Heine, Heinrich :: Gedichte | Deutschland. Ein Wintermärchen | 1812 - 1827 | 2. Abteilung: Verstreut gedruckt Gedichte | Burleskes Sonett
Kunst geht nach Brot, heißt es, aber man hat vergessen hinzuzufügen - meist vergeblich.
Trotzdem. Armut und Hunger, soziale Ausgrenzung und lebenslanger Mißerfolg schrecken die Dichter, zumindest nicht die, die mit ihrem Herzblut schreiben, nicht ab, weiter unermüdlich Verse zu verfassen, auch wenn, so steht zu befürchten, die wenigsten unter ihnen in der Lage sind, die brotloseste der Künste so heiter zu ertragen wie Heine, welcher nicht auf die Worte seines reichen Onkels hörte: Hätten gelernt machen Geschäfte, hätten nicht brauchen schreiben Gedichte.
2. Die Dichter oder Das lyrische Bedürfnis
Nein, Geschäfte machen die Dichter keine; sie machen Gedichte, lange kurze, gute schlechte, gereimte ungereimte. Wenn's gut läuft, werden sie verlegt, wenn's besser läuft, erhalten sie einen Lyriker-Preis und manchmal schafft's einer unter ihnen bis nach Stockholm zum materiellen Hauptpreis. Bekannt werden wenige, berühmt noch weniger - vergessen die meisten. Und doch wurde geschrieben und wird weiter geschrieben.
Aber warum nur?
Warum wir immer noch Verse schreiben?
Um unbekannt und ungestört zu bleiben.
antwortet Christian Morgenstern (im Scherz) und hoffte selbstredend auf das Gegenteilige.
Scherz beiseite.
Dieser brotlosesten aller Künste liegt, so behaupte ich, ein lyrisches Bedürfnis zugrunde. Mag dieses lyrische Bedürfnis seinen Ursprung in Musik und Rhythmus haben, wie Nietzsche es will, oder, wie ich vermute, Teil jenes Verlangens nach künstlerischem Ausdruck sein, wie er sich schon früh in der Menschheitsgeschichte an den beeindruckenden Höhlenmalereien des Cro-Magnon-Menschen bewundern läßt. Wie dem auch sei, es ist da, so wie der Trieb der Arterhaltung und der Destruktionstrieb. Die Produkte, die dieses lyrische Bedürfnis hervorbrachte und immer noch hervorbringt, sind so vielfältig und verschieden wie ihre Schöpfer.
Sie reichen von Pindars gehobenen Siegesgesängen über Goethes bedeutende Gelegenheitsgedichte (dazu gleich mehr) bis zu den Lautgedichten Ernst Jandls und den Tollheiten des Dadaismus.
Nichts Menschliches (und “Unmenschliches”) ist der Lyrik fremd, könnte man sagen, und ziemlich wahrscheinlich ist die Kunst überhaupt das einzige Terrain, auf dem man alle “Möglichkeiten” des Menschen ausspielen kann, ohne ins Gefängnis zu kommen oder ins Irrenhaus eingeliefert zu werden.*
* Anmerkung: Daß dem leider nicht so ist, beweisen die Verfolgungen, die Dichter von Anfang an erlitten haben. Ich werde in einem zukünftigen Spaziergang darauf zurückkommen.
Doch nicht nur Themen und Formen der Dichtung sind mannigfaltig, auch die je individuelle Motivation und die Anlässe zu schreiben unterscheiden sich, sind historisch und sozial bis zu einem gewissen Grade bedingt.
Ein deutliches Beispiel bietet der Vergleich Goethe - Hölderlin. Der Opposition der beiden - die auch biographisch nachweisbar ist - liegt nicht allein in den sehr differenten Positionen, die beide in der damaligen Literaturszene einnahmen; auf der einen Seite der Übervater der deutschen Poesie, der weltberühmte Weimarer “Geistesfürst” und ihm gegenüber das junge rätselhafte, den Klassikern (und nicht nur ihnen) unverständliche Genie, das schließlich sich von der Welt in einen Tübinger Turm zurückzog. Die Unvereinbarkeit der beiden Temperamente zeigt sich auch in der konträren Auffassung, wie man dichten müsse.
Um die Art seiner Gedichte zu beschreiben, verwendet Goethe den Begriff Gelegenheitsgedicht, der heute - wenn nicht schon pejorativ - eher für unbedeutende Nebenwerke steht, oder ganz der Sphäre der “Amateurdichter” angehört.
Die Welt ist so groß und reich und das Leben so mannigfaltig, daß es an Anlässen zu Gedichten nie fehlen wird. Aber es müssen alles Gelegenheits-gedichte sein, das heißt, die Wirklichkeit muß die Veranlassung und den Stoff dazu hergeben. Allgemein und poetisch wird ein specieller Fall eben dadurch, daß ihn der Dichter behandelt. Alle meine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte, sie sind durch die Wirklichkeit angeregt und haben darin Grund und Boden. Von Gedichten aus der Luft gegriffen halte ich nichts.
(Eckermann, Gespräche mit Goethe, 17.9.1823)
Und geradezu als Anweisung für junge Dichter gibt er in gereimter Form zu Protokoll:
Willst du dich als Dichter beweisen,
So mußt du nicht Helden noch Hirten preisen.
Hier ist Rhodus! Tanze, du Wicht,
Und der Gelegenheit, schaff' ein Gedicht!
Goethe, Johann Wolfgang von :: Gedichte. Dritter Teil | Zahme Xenien | III
Undenkbar, daß sich ein Dichter wie Hölderlin von solchen Zeilen hätte angesprochen fühlen können.
Die Welten, die beide trennt, werden deutlich, wenn man Hölderlins Gedicht An die Parzen dagegen hält:
An die Parzen
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heilge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
Hölderlin, Friedrich :: Gedichte | 1796-1798 | An die Parzen
Hier entzündet sich das lyrische Bedürfnis nicht an einer Gelegenheit, die die Wirklichkeit zufällig bietet und die nur darauf wartet in dichterische Form umgeschmolzen zu werden, hier spricht ein Dichter, bei dem das Werk die Existenz und die Existenz das Werk ist. In dieser Radikalität, mit der Hölderlin Leben und Dichten zur Deckung bringt, steht er - soweit ich sehe (am ähnlichsten kommt ihm vielleicht noch Kleist, welcher ebenfalls an Goethe scheiterte) - ganz vereinzelt in der deutschen Literatur. Und es ist gewiß kein Zufall, daß er vom biederen und an andere Töne gewohnten Bürgertum im 19. Jahrhundert völlig ignoriert wurde. Hölderlin paßte nicht in die Goldschnittlyrik der Zeit, die auf Erbauung und hohlen Idealismus setzte. Ob allerdings Hölderlins Vereinnahmung durch eine ontologisch ausgerichtete Philosophie, nach seiner Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert, dem erratischen Werk, das wie ein Solitär aus der Masse der Durchschnittslyrik ragt, gerecht wird, kann mit guten Gründen bezweifelt werden.
So wie jeder Dichter (und selbstverständlich auch jeder Nicht-Dichter) verschieden ist, was seine individuelle Konstitution (seine Begabung, sein Temperament, seine Erfahrungen etc.) und seine sozialen Umstände angeht, und jeweils in einer historisch gegebenen Lebenswelt sich orientiert (der eine erfolgreich, der andere erfolglos), so stehen auch die Gedichte zum einen allein und für sich und wirken aus sich heraus (oder auch nicht), zum anderen als Teil eines Gesamtwerkes in einem historischen Kontext.
Und daher läßt sich der Gemeinplatz nicht vermeiden: die Lyrik ist immer auch Kind einer Zeit. Zeitlosigkeit, ein unverändertes Schweben über dem Getriebe der Welt, Ewiges gar, gleichsam als lyrisches Unesco-Weltkulturerbe, gibt es in der Lyrik so wenig, wie in allen Werken der Menschen und in der Natur selbst. Irgendwann läutet auch dem “schönsten”, dem “besten”, dem “berühmtesten” Gedicht die letzte Stunde - und das hat dann doch angesichts der eignen Endlichkeit etwas Tröstliches.
3. Die Leser oder Anything goes
Und doch liegt in der Zeitlichkeit der Gedichte (wie aller Werke) ein vertracktes Problem. Aus der Sicht des Lesers, um die es hier nur geht, liegt jedes Gedicht immer schon in der Vergangenheit, mag auch bei der sog. zeitgenössischen Lyrik der Abstand gering, zuweilen - wenn der Verfasser einem Leser ein soeben geschriebenes Gedicht in die Hand gibt - sogar nur Minuten betragen. Von den im di-lemmata-Korpus verzeichneten Werken, um die es in den Spaziergängen hauptsächlich geht, trennen uns zwischen 70 und 260 Jahre.
Georg Heyms Gedichtsammlung Der ewige Tag wurde vor hundert Jahren, Goethes West-östlicher Divan vor rund zweihundert Jahren veröffentlicht. Goethes und Heyms Gegenwart ist nicht unsere. Was bedeutet das für die Lektüre? Nichts, antworten die Vertreter der Zeitlosigkeit und zitieren gern Hölderlins Wort: Was bleibet aber, stiften die Dichter. Nach Auschwitz kann man kein Gedicht mehr schreiben, meinte Adorno, abhold jeder Zeitlosigkeit; aber kann man nach Auschwitz noch Gedichte lesen? Und wenn ja, kann man sie so lesen, als hätte es Auschwitz nie gegeben? Oder muß man nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts die Gedichte anders lesen, genauer: kann man sie nur anders lesen? Oder soll, muß, kann man die Werke der Vergangenheit, wie der Historismus es will, auch mit den Augen der Vergangenheit lesen?
Aber halt. Schießen wir bei solchen Fragen nicht mit Kanonen auf Spatzen? Überborden wir nicht die schlichte Lektüre eines harm- und wehrlosen Gedichts mit einem sozial-philosophischen Propädeutikum, dessen Absolvierung zur Voraussetzung eines Leseakts gemacht wird, der manchmal nicht einmal eine Minute dauert?
Also doch Versenkung ins Zeitlose, mystische Wesensschau des “Bleibenden, das die Dichter stiften”? Aber dafür wäre dann wieder ein Sommerkurs an der Freiburger Universität über Hermeneutik und Seinsauslegung fällig.
Warum überhaupt all diese Fragen? Ein jeder liest, was er will und wie er will; es gibt kein Lesen-Sollen oder gar ein Lesen-Müssen; es gibt nur ein anything goes. Mit diesem Schlagwort kämpfte Paul Feyerabend gegen den Methodenzwang in der Wissenschaft und entwarf eine Erkenntnis für freie Menschen. Um wieviel mehr gilt diese Maxime für die Lektüre von Gedichten! Zehn Leser desselben Gedichts lesen zehn verschiedene Gedichte - und das ist auch gut so.
Aber zurück zur zeitlichen Differenz zwischen Gedicht und Leser.
Ein Beispiel: 1795 (also vor 217 Jahren) erschien Schillers Gedicht Würde der Frauen, es setzt ein:
Ehret die Frauen! Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben,
Flechten der Liebe beglückendes Band,
Und in der Grazie züchtigem Schleier
Nähren sie wachsam das ewige Feuer
Schöner Gefühle mit heiliger Hand.
Ewig aus der Wahrheit Schranken
Schweift des Mannes wilde Kraft;
Unstät treiben die Gedanken
Auf dem Meer der Leidenschaft;
Gierig greift er in die Ferne,
Nimmer wird sein Herz gestillt;
Rastlos durch entlegne Sterne
Jagt er seines Traumes Bild.
[...]
Kann man heute, im Jahre 2012, diese Zeilen, die wohl vom Verfasser ernst gemeint sind, ohne Kopfschütteln lesen? Ist dieser deklamatorische Tonfall noch erträglich? Und was mag einem Leser heute beim züchtigen Schleier durch den Kopf gehen? Und fährt einem nicht ein leichter Schauer über den Rücken, wenn man sich vor Augen hält, wie dieses Gedicht in manchen Bürgerstuben im 19. Jahrhundert unter brutalen patriarchalischen Bedingungen erbauend rezipiert wurde? Oder liegt hier eben jene historische Differenz vor, die es gilt bei der Lektüre zu berücksichtigen, um dem Werke Gerechtigkeit angedeihen zu lassen? Aber was hieße das denn, einem Werke in seiner Zeit gerecht zu werden? Wäre damit das Gedicht inhaltlich “gerettet”, wenn man sich - wie immer das auch gelingen mag - in die Zeit um 1800 in das Duodezfürstentum Weimar versetzte? Und wüßte man dann mehr wenigstens über diese Zeit und könnte sagen, daß dieser gereimte Entwurf das Frauenbild der Zeit abgab, wenn auch zugestandenermaßen als ein Idealbild? Nun, offenbar waren schon einige Zeitgenossen Schillers von dessen Gedichten nicht sonderlich angetan. Als im Kreise der Romantiker Schillers Lied von der Glocke gelesen wurde, fielen sie, wie Caroline Schlegel berichtet, vor Lachen unter die Stühle.
Und so ist man nicht überrascht, daß auch die Würde der Frauen eine Rezeption bei einem der Wortführer der damaligen jungen Generation erhielt, die den Klassiker wenig erfreut hätte:
Schillers Lob der Frauen
Parodie.
Ehret die Frauen! Sie stricken die Strümpfe,
Wollig und warm, zu durchwaten die Sümpfe,
Flicken zerrissene Pantalons aus;
Kochen dem Manne die kräftigen Suppen,
Putzen den Kindern die niedlichen Puppen,
Halten mit mäßigem Wochengeld Haus.
Doch der Mann, der tölpelhafte
Find't am Zarten nicht Geschmack.
Zum gegornen Gerstensafte
Raucht er immerfort Taback;
Brummt, wie Bären an der Kette,
Knufft die Kinder spat und fruh;
Und dem Weibchen, nachts im Bette,
Kehrt er gleich den Rücken zu. Usw.
Erwiderung der Jungfrauen und Junggesellen.
Die Jungfrauen.
Du schiltst die Männer, um die Frau'n zu loben.
Wie ungeschickt, o Schiller! wie verschroben!
Wir können nicht den Bräutigam entbehren:
Nun willst du uns, ihn zu verabscheu'n, lehren?
Nein, geh zu Rat bei'm Wiener Schikaneder!
Der gibt das Seine Jedem so wie Jeder.
“Bei Männern, welche Liebe fühlen,
Fehlt auch ein gutes Herze nicht.
Die sanften Triebe mitzufühlen
Ist dann der Weiber erste Pflicht.
Mann und Weib und Weib und Mann
Reichen an die Gottheit an.”
Die Junggesellen.
Pereat Schiller!
Wir fragen: Was will er?
Der moralische Phantast
Macht uns Männer den Frauen verhaßt.
Wären wir beide so, wie er sagt,
So wären wir mit einander geplagt.
Unser Schikaneder lebe!
Laßt uns seine weisen Lehren
Eifrig durch die Tat bewähren!
Jeder edle Jüngling strebe
So wie jedes holde Weib,
Daß im Bund von Seel' und Leib
Nach dem heil'gen Schwur der Treue
Alles sich des Lebens freue,
Und die junge Welt erneue.
Schlegel, August Wilhelm :: Gedichte | Scherzhafte Gedichte | Schillers Lob der Frauen
Friedrich Schiller, der große Friedrich Schiller möge sich Rat einholen bei dem Wiener Hallodri Schickaneder, welcher seinen Nachruhm allein Mozarts Zauberflöte verdankt! Heißt das nicht schon, um aus dem Lied der Glocke zu zitieren, mit Entsetzen Spott treiben?
Aber vielleicht liegt gerade in der Parodie, wenn nicht der Gebrauchswert der Schillerschen Würde der Frauen, immerhin ihr Unterhaltungswert. Kaum ein Dichter aus dem deutschen Lyrik-Kanon läßt sich so ergiebig parodieren wie Schiller und vielleicht bereitet gerade das parodistische Potential, das in dieser Lyrik steckt, ein Vergnügen, das der Verfasser dieser Zeilen nicht vorhersehen konnte, geschweige denn intendiert hätte, dem er aber sich doch gerne beugen würde, wenn denn richtig ist, was er im Prolog zu seinem Wallenstein-Drama schrieb: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
Nachbemerkung für alle Bewunderer Schillers: Keineswegs soll hier das bedeutende Werk Schillers zu einem Steinbruch für Parodien degradiert werden. Jeder mag die Würde der Frauen oder das Lied von der Glocke lesen, wie er will (eben: anything goes) und es gibt sicherlich Leser, die aus diesen und anderen Werken Gewinn in Form von Sinnerweiterung oder gar Lebenshilfe ziehen. (Mit literaturwissenschaftlichen Analysen aus allen methodischen Ecken und Moden hat Lesen im originären Sinne nichts zu tun, universitäre Profi-Leser enthalten sich meist jeder angeblich subjektiven Stellungnahme, weshalb in ihren Schriften die Begriffe Vergnügen oder Langweile so selten vorkommen, obwohl sie in der Regel diese eher als jenes verbreiten.)
Jedes Werk kann parodiert werden, besonders die idealistischen, zumal wenn ihnen ein Pathos eingeschrieben ist, das modernen Ohren eher hohl klingt. Aber der Hauptgrund für die Parodie-Anfälligkeit jeder Idealität liegt darin, daß sie sich vor der trivialen Realität immer blamiert. Die Differenz zwischen idealer und realer Welt wird interessanterweise von der bürgerlichen Welt umstandslos kassiert, und zwar durch Fraktionierung nach der Devise: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. So wie der sonntägliche Kirchgang weitgehend ohne Folgen für den alltäglichen Umgang mit dem Nächsten ist, so wird auch jeder ethische Idealismus zur Kenntnis, aber nicht ernst genommen. Schnaps ist eben Schnaps undsoweiter...
Daß bei Friedrich Schiller aber auch andere Töne zu finden sind, zeigt folgendes Distichon:
Würde des Menschen
Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen,
Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst.
Schiller, Friedrich von :: Gedichte | Zerstreute Epigramme | Würde des Menschen
Genau!
4. Das Material: die Wörter
Aber woran liegt es, daß das lyrische Bedürfnis sich über Jahrtausende gehalten und als unzerstörbar erwiesen hat? Warum erlagen und erliegen immer wieder Menschen, dem Drang, sich hinzusetzen und Gedichte zu schreiben? Gewiß, auch die Malerei kennt unzählige Hobbymaler und weniger unzählige, aber gewiß genug unbekannte Genies, die in ärmlichen Ateliers ihrer Kunst nachgehen und sicher auch genügend Musiker, die auf ihren Durchbruch hoffen. Aber ich bin überzeugt (auch hier wieder ohne es in Zahlen zu belegen können), daß sich in keiner “Kunst” so viele versuchen wie in der Lyrik. Warum? Nun, zum einen ist der Zeitaufwand gering (verglichen mit dem Abfassen etwa eines Romans), was Mascha Kaléko trefflich in einem Zweizeiler ironisiert:
Im Telegrammstil
Langschweifig lamentieren Philosophen
Ein Lyriker stirbt oft schon in drei Strophen.
aus: Mascha Kaléko, Die paar leuchtenden Jahre, S. 54
Und zum anderen ist das Arbeitsmaterial schon immer da, nicht nur umsonst, sondern auch in reichem Maße: die Wörter.
Wörter?
Jean Paul Sartre gab seinen brillant geschriebenen Kindheitserinnerungen den Titel Les mots; ein Titel, der den deutschen Übersetzer in Verlegenheit brachte. Die Worte oder die Wörter? Bekanntlich entschied er sich, zurecht, für Die Wörter.
Die Grammatiker stellen den zusammenhängenden Worten, die einen Gedanken auszudrücken pflegen, die Ansammlung unzusammenhängender Wörter, z.B. in einem Wörterbuch, das daher auch nicht Wortebuch sich nennen darf, gegenüber. (Aber die Sprache stellt zuweilen den Grammatikern ein Bein und so spricht man denn von Sprichwörtern statt von zu erwartenden Sprichworten.)
Einer, der mit seiner Sprachkolumne “Zwiebelfisch” erfolgreich durch das Reich der Medien schwimmt, faßt den Unterschied bündig so zusammen: Um es auf eine Formel zu bringen: Wörter bestehen aus Buchstaben, Worte bestehen aus Gedanken. [*] Ob man die armen Wörter jeden Gedankens beraubt als pure Buchstabengerippe so im grammatischen Regen stehen lassen kann, mag aus guten Gründen bezweifelt werden; denn haben sich nicht seit Platons Tagen Philosophen (die Freunde der Weisheit) und Philologen (die Freundes des Wortes) in unzähligen Schriften darum bemüht, die Bedeutungen zu erkunden, die doch offensichtlich in dieser Ansammlung von Buchstaben stecken - und stecken in den Bedeutungen keine Gedanken? Wort - Bedeutung - Gedanke, ergänzt durch Begriff - Idee - Welt (oder auch andere gleichartige Mitspieler bei der beliebten Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Denken), und schon ist man in einem Netz von Hypothesen verfangen, das immer weiter zu knüpfen Philosophie, Psychologie, Linguistik und leider auch Theologie sich offenbar verpflichtet fühlen. Hiervon nun nichts, die Diskussion wird weitergehen, und solange nicht ein materielles Substrat des Bewußtseins erwiesen ist, wird man kaum zu einem anderen Ergebnis kommen, daß Sprache (mithin also die Wörter und ihre Bedeutungen) und Denken “irgendwie” zusammenhängen, sicherlich auch noch verknüpft mit nichtsprachlichen Vorstellungselementen, ja vielleicht wirken selbst Gestik und Mimik zurück auf das Denkvermögen. Wie dem auch sei, interessanter für den Gang zu den Wörtern, dem Material der Dichter, ist mir eine andere Frage. Da nun mal das Deutsche die Unterscheidung zwischen (mehr oder weniger) sinnvoll zusammengesetzten Worten und isoliert stehenden Wörtern trifft, kann man die Frage stellen: Bestehen Gedichte nun aus Wörtern oder Worten? Eine absurde Frage, wird mancher denken, selbstverständlich aus Worten, wird er kopfschüttelnd antworten.
Gewiß bestehen die meisten Gedichte aus zusammenhängenden Worten, die den Sinn stiften, mag er nun in oder zwischen oder über den Zeilen liegen (da gehen die Ansichten bekanntlich weit auseinander), und doch scheint es bei den poetischen Erzeugnissen mehr auf das einzelne Wort als den diskursiven Zusammenhang anzukommen. Sagt doch schon Eichendorff:
Wünschelrute
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Eichendorff, Joseph von :: Gedichte | Sängerleben | Wünschelrute
Auf das eine Wort also kommt es an, das eine Wort, das aus “den Dingen”, sprich aus der Welt, die Poesie zaubert. So ist in Eichendorffs Vierzeiler das Wort “Zauberwort” selbst das Zauberwort, das die Welt zum Singen bringt - wenn man es denn nachempfindet und nicht über die romantische Naivität lächelt.
Daß das Zauberwort auch viel tiefer als bei Eichendorff begriffen werden kann, ja geradezu als Existenzial, zeigt folgendes Werk aus der Feder Annette von Droste-Hülshoffs:
Lebt wohl
Lebt wohl, es kann nicht anders sein!
Spannt flatternd eure Segel aus,
Laßt mich in meinem Schloß allein,
Im öden geisterhaften Haus.
Lebt wohl und nehmt mein Herz mit euch
Und meinen letzten Sonnenstrahl;
Er scheide, scheide nur sogleich,
Denn scheiden muß er doch einmal.
Laßt mich an meines Seees Bord,
Mich schaukelnd mit der Wellen Strich,
Allein mit meinem Zauberwort,
Dem Alpengeist und meinem Ich.
Verlassen, aber einsam nicht,
Erschüttert, aber nicht zerdrückt,
Solange noch das heil'ge Licht
Auf mich mit Liebesaugen blickt.
Solange mir der frische Wald
Aus jedem Blatt Gesänge rauscht,
Aus jeder Klippe, jedem Spalt
Befreundet mir der Elfe lauscht.
Solange noch der Arm sich frei
Und waltend mir zum Äther streckt
Und jedes wilden Geiers Schrei
In mir die wilde Muse weckt.
Droste-Hülshoff, Annette von :: Gedichte | Aus: Letzte Gaben 1862 | Denkblätter | Lebt wohl
Hier steht das Zauberwort, zusammen mit einem Alpengeist und dem Ich, für die dichterische Existenz selbst ein, ganz in der Tradition jenes oft beschriebenen, besungenen, beklagten Gegensatzes von Kunst und Leben; eines Gegensatzes, der nach dem Selbstverständnis vieler Dichter unaufhebbar ist. Es geht also bei Annette von Droste-Hülshoff, welche von einer bedenkenlosen Literaturgeschichtsschreibung allzu leichtfertig in die Schublade idyllischer Biedermeier-Harmlosigkeit ausgelagert wird, nicht nur darum, mit einem Zauberwort, den Dingen ein Lied zu entlocken, sondern überhaupt auf jene eigentümliche Disposition ihrer Natur hinzuweisen, die bis zum letzten Atemzug sich ganz ihrer wilden Muse verpflichtet fühlt. Allein der Ausdruck “wilde Muse” zeugt von einer Leidenschaft, die sich selbst durch persönliche Niederlagen und eine bornierte patriarchalische Umwelt nicht unterkriegen lassen will.*
* Fußnote: Die herablassende Arroganz männlicher Dichter-Kollegen läßt sich an folgenden Urteilen ablesen:
Natürlich ist alles stimmungsreich und wirkungsvoll, solch Inhalt muß wirken, aber das Maß der Kunst oder gar der Technik ist nicht hervorragend.
Theodor Fontane
Die Droste-Hülshoff ist für mich von allen dichtenden Frauen die respektabelste poetische Kraft. Freilich fehlt auch hier die letzte Vollendung; aber der poetische Instinkt ist enorm und doch auch vieles trefflich durchgeführt.
Theodor Storm
Ein letzter Beitrag zur Bedeutung des Wortes in der Lyrik. In den beiden thematisch zusammengehörenden Gedichten bietet Goethe in poetischer Form nichts weniger als den Kern seiner Poetik.
Offenbar Geheimnis
Sie haben dich, heiliger Hafis,
Die mystische Zunge genannt
Und haben, die Wortgelehrten,
Den Wert des Worts nicht erkannt.
Mystisch heißest du ihnen,
Weil sie Närrisches bei dir denken
Und ihren unlautern Wein
In deinem Namen verschenken.
Du aber bist mystisch rein,
Weil sie dich nicht verstehn,
Der du, ohne fromm zu sein, selig bist!
Das wollen sie dir nicht zugestehn.
Goethe, Johann Wolfgang von :: West-östlicher Divan | 2. Hafis Nameh. Buch Hafis | Offenbar Geheimnis
Wink
Und doch haben sie Recht, die ich schelte:
Denn, daß ein Wort nicht einfach gelte,
Das müßte sich wohl von selbst verstehn.
Das Wort ist ein Fächer! Zwischen den Stäben
Blicken ein paar schöne Augen hervor,
Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor,
Er verdeckt mir zwar das Gesicht,
Aber das Mädchen verbirgt er nicht,
Weil das Schönste, was sie besitzt,
Das Auge, mir ins Auge blitzt.
Goethe, Johann Wolfgang von :: West-östlicher Divan | 2. Hafis Nameh. Buch Hafis | Wink
Auf die Hervorhebung der poetischen Sprache als der eigentlichen und auf die Bedeutung des Symbols für die Dichtung Goethes habe ich bereits in den Vorbereitungen hingewiesen [*]. Die Arbeiten über Goethe und den Symbolbegriff überhaupt füllen Bibliotheken und vermutlich gibt es längst Spezialisten, die haargenau (oder auch nicht) zwischen Allegorie und Symbol und Metapher zu unterscheiden wissen. Inwieweit all diese theoretischen Entwürfe hilfreich sind, die beiden Gedichte zu “interpretieren” oder zu “deuten” oder auch nur die verschiedenen Symboltypen (angeblich gibt es drei davon) in ihnen ausfindig zu machen, mag dahingestellt bleiben. Meine Überlegungen zielen allein auf die Art und Weise, wie hier “das Wort” (nämlich das poetische Wort) verstanden wird. Die Wortgelehrten, so läßt Goethe verlauten, hätten den Wert des Wortes nicht verstanden, sie halten es für mystisch. Dem setzt Goethe den innovativen Begriff “mystisch rein” entgegen. Das poetische Wort ist eben nicht verschwommen, dunkel, wie die Wortgelehrten meinen, da Gelehrtheit immer auf Erklärung, Deutlichmachen zielt. Das poetische Wort kann eben nicht auf den (wissenschaftlich exakten) Begriff gebracht werden, und Goethe verdeutlicht das “Wesen” dieses Wortes mittels einer Analogie zu Hafis' Lebensauffassung, er ist nämlich selig ohne fromm zu sein. Man kann darin auch Goethes eigne Lebensmaxime ablesen: heidnische Seligkeit, nur ein scheinbarer Widerspruch. Das poetische Wort nimmt den Widerspruch auf, ja es lebt in und von diesem Widerspruch. Und in der Synthesis dieses Widerspruchs liegt der wahre Wert des Wortes, seine Symbolik, die sich aber nicht begrifflich wiedergeben läßt.
Oder - und darauf zielt das Gedicht Wink - das Wort ist ein Fächer; es gibt nur einen Teil seiner Bedeutung, wenn auch einen wichtigen, den Blicken preis. Vieles bleibt verborgen, aber nicht verborgen im Sinne der Unerkennbarkeit, sondern verborgen als eine Herausforderung an die Vorstellungskraft, an die Phantasie. Und darin liegt ja genau das Faszinierende an der Poesie, sie ist offenbar und geheimnisvoll zur gleichen Zeit. Das Offenbare und das Geheimnis, das Diskursive und das Inkommensurable ergänzen einander, gehen ineinander über. Und jedem Leser bleibt es überlassen, nach seinem eignen Vermögen und eignem Gusto, sich auf dieses offenbare Geheimnis einzulassen - oder auch nicht.
Selbstredend ist mit diesen, wenn ich so sagen darf, poetischen Stellungnahmen nicht belegt, daß Gedichte aus Wörtern und nicht aus Worten bestehen, aber kaum von der Hand zu weisen ist, daß das einzelne Wort in der Poesie eine viel gewichtigere Rolle spielt als in literarischen Prosa-Werken, von journalistischen und ähnlichen Textproduktionen ganz zu schweigen. Die Wörter lösen sich im Gedicht eben nicht wie in den genannten Texten in sinngebende Worte, in Diskursivität auf, sondern führen in dem syntaktischen und auch semantischen Zusammenhang, in dem sie stehen, immer noch ein Eigenleben, gleichsam sich selbst als Symbolträger, um es mit Goethe zu deuten. Nicht allein der Reim (gleich ob End- oder Stabreim) beweist, daß einzelne Wörter im poetischen Kontext eine besondere Bedeutung innehaben; auch der Vers überhaupt, also die Hervorhebung einzelner Worte durch eine der Normalprosa widersprechenden Position, deutet in die gleiche Richtung.
Wörter - Worte, der ganze Umweg - aber wie manche Umwege ein (hoffentlich) bereichernder - diente allein zu begründen, daß es durchaus lohnenswert ist, die Wörter aus den poetischen Werken aufzVuspießen und sie in ein Panoptikum zu stellen.
5. Die häufigsten Substantive
Die Wörter also. Aber welche? Ich wähle zunächst die Substantive, die die Kinder in der Grundschule zuallererst als Hauptwörter kennenlernen. Und der Begriff Hauptwort paßt hinsichtlich der Poesie nicht schlecht, denn meiner Ansicht nach sind die Substantive tatsächlich die Haupt-Wörter der Dichtung, zusammen mit den Verben und Adjektiven (zusammengefaßt als Hauptwortarten) tragen sie die semantische Last der Texte.
Das di-lemmata-Korpus enthält derzeit insgesamt 615.613 Substantive, die sich auf 51.503 Lemmata (Lexeme) verteilen. Die zwanzig häufigsten sind:
| Lemma | Freq. |
|---|---|
| Herz | 7.336 |
| Gott | 5.641 |
| Nacht | 4.758 |
| Auge | 4.663 |
| Leben | 4.628 |
| Hand | 4.332 |
| Liebe | 4.280 |
| Tag | 4.202 |
| Welt | 3.998 |
| Himmel | 3.766 |
| Kind | 3.491 |
| Erde | 3.221 |
| Seele | 3.145 |
| Mensch | 3.107 |
| Geist | 3.015 |
| Licht | 2.897 |
| Zeit | 2.818 |
| Sonne | 2.801 |
| Mann | 2.628 |
| Blick | 2.620 |
| Summe: | 77.347 |
Ist mit diesen zwanzig häufigsten Substantiven (sie machen 12,6% aller vorkommenden Wortformen der Wortart aus) sozusagen der Kernwortschatz der deutschen Poeten von der “Aufklärung” bis zum “Expressionismus” greifbar? Befinden wir uns mitten in der Werkstatt der poetischen Intuition? Oder waltet nur der “Zufall”, die Willkür der Grenzziehung (das Lexem Haus kommt lediglich 27 mal weniger vor als Blick - bei der Beleglage von weit über 2500 eine Winzigkeit)? Jede Grenze ist problematisch, aber unsere Liste weist zumindest eine Signifikanz auf, die nicht auf Zufälligkeit beruhen kann. Die bei weitem häufigsten Lexeme im besagten Zeitraum sind Herz und Gott. (Es wäre nicht uninteressant zu wissen, ob auch in der französischen, englischen oder italienischen Poesie des gleichen Zeitraums diese beiden Lexeme vorherrschen.)
Herz und Gott - Alpha und Omega der Poesie? Sind große Teile der deutschen Poesie gar religiöse Erbauungslyrik? Oder nur Indizien für eine Tendenz zur Innerlichkeit, eine These, die durch die ebenfalls hochfrequenten Substantive Seele, Liebe, Geist und vermutlich auch Nacht noch gestützt zu werden scheint?
Vor weiteren Mutmaßungen sei eine Wort-Erhebung dagegen gehalten, die der Duden-Verlag zu den häufigsten Substantiven der Alltagssprache durchgeführt hat. [*]
| Allgemeinwortschatz (Duden-Korpus) |
poetischer Wortschatz (di-lemmata-Korpus) |
|
|---|---|---|
| 1 | Jahr | Herz |
| 2 | Uhr | Gott |
| 3 | Prozent | Nacht |
| 4 | Million | Auge |
| 5 | Euro | Leben |
| 6 | Zeit | Hand |
| 7 | Tag | Liebe |
| 8 | Frau | Tag |
| 9 | Mensch | Welt |
| 10 | Mann | Himmel |
| 11 | Land | Kind |
| 12 | Deutschland | Erde |
| 13 | Kind | Seele |
| 14 | Ende | Mensch |
| 15 | USA | Geist |
| 16 | Stadt | Licht |
| 17 | Seite | Zeit |
| 18 | Woche | Sonne |
| 19 | Leben | Mann |
| 20 | Berlin | Blick |
Auch wenn der Zeitunterschied nicht unbeträchtlich ist (die Duden-Statistik stammt aus dem Jahr 2001; das di-lemmata-Korpus umfaßt den Zeitraum von Mitte des 18. Jahrhundert bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts), so kann man trotzdem davon ausgehen, daß im Großen und Ganzen das Alltagsvokabular zumindest die gleiche Tendenz zeigt.*
* Fußnote: Für die Bereitstellung einer vergleichbaren Statistik zur Alltagssprache, die in etwa den di-lemmata-Zeitraum abdeckt, wäre ich sehr dankbar.
Bei Vergleichung der beiden Wortlisten fallen folgende Unterschiede sofort ins Auge:
- Eigennamen werden nach den Kategorien von di-lemmata als eigene Wortart geführt, aber selbst wenn man sie einrechnete, spielten sie quantitativ keine Rolle (der häufigste Eigenname im di-lemmata-Korpus ist übrigens “Jesus Christus”).
- Begriffe, die im weiteren Sinne in das Wortfeld Zeit gehören nehmen im Alltagswortschatz einen breiten Raum ein (Jahr, Uhr, Woche, Zeit, Tag).
- In der Duden-Liste fehlen Wörter des Gefühls vollständig.
- In der Duden Wortliste tauchen einige Begriffe aus dem im weiteren Sinne ökonomischen Bereich auf (Million, Prozent, Euro, früher: Mark), die der di-lemmata-Liste fremd sind. Zum Beispiel kommt das Lexem Prozent im gesamten di-lemmata-Wortschatz nur ein einziges Mal vor, und zwar in Heinrich Heines Das Sklavenschiff. Überhaupt ein ungewöhnlich realistisches Werk; es ist (soweit ich sehe) eine der ersten poetischen Darstellungen von Rang, die die kapitalistische Ausbeutung von Mensch und Natur zum Gegenstand hat. Diese Außergewöhnlichkeit ist es wohl wert, an dieser Stelle den Anfang des Gedichtes vorzustellen.
Das Sklavenschiff
I
Der Superkargo Mynheer van Koek
Sitzt rechnend in seiner Kajüte;
Er kalkuliert der Ladung Betrag
Und die probabeln Profite.
“Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut,
Dreihundert Säcke und Fässer;
Ich habe Goldstaub und Elfenbein -
Die schwarze Ware ist besser.
Sechshundert Neger tauschte ich ein
Spottwohlfeil am Senegalflusse.
Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm,
Wie Eisen vom besten Gusse.
Ich hab zum Tausche Branntewein,
Glasperlen und Stahlzeug gegeben;
Gewinne daran achthundert Prozent,
Bleibt mir die Hälfte am Leben.
Bleiben mir Neger dreihundert nur
Im Hafen von Rio-Janeiro,
Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stück
Das Haus Gonzales Perreiro.”
[...]
Heine, Heinrich :: Gedichte | Gedichte 1853 / 1854 | 6 Das Sklavenschiff
Zurück zu dem Vergleich! Auch unter dem Vorbehalt der zeitlichen Differenz und der beschränkten Anzahl von Lexemen läßt sich, wenn auch nur vage und gemischt mit Vermutungen und Vorurteilen*, sagen, daß der Wortschatz der Poeten in den Haupt-Wörtern, den Substantiven, Begriffe aus dem widerspiegelt, was zum Wortfeld Innerlichkeit, Gefühl, Seele etc. gehört. Insofern scheint das gängige Klischee bedient zu werden, nach dem Gedichte hauptsächlich “Irrationales” (oder neutraler: “Nicht-Reales”) nicht nur zur, sondern auch in Sprache bringen. Ob dieses Klischee berechtigt ist, wird sich erst noch in weiteren Spaziergängen durch die poetischen Wälder erweisen müssen. Vorweg: ich denke nicht, daß das Klischee berechtigt ist. Einen ersten Eindruck über die Vielfältigkeit des poetischen Selbstverständnisses können folgende Vergleiche geben.
* Fußnote: Vorurteil wird hier nicht in einem pejorativen Sinne verstanden, sondern als eine Bedingung der Möglichkeit von Urteilen.
Zahlreich sind die Gedichte, in denen der Dichter und die Poesie selbst das Thema sind, und so unterschiedlich sie auch sein mögen, die meisten feiern den Dichter und seine Sicht der Welt als etwas Singuläres, etwas, das sich vom öden Getriebe der Welt abhebt. Für Hölderlin sind Dichter gar heilige Gefäße und in einem Eichendorff-Gedicht werden nahezu alle Topoi der Innerlichkeit und der Besonderheit der dichterischen Existenz, so wie der Romantiker sie verstand, in gereimte Strophen gebracht:
An die Dichter
Wo treues Wollen, redlich Streben
Und rechten Sinn der Rechte spürt,
Das muß die Seele ihm erheben,
Das hat mich jedesmal gerührt.
Das Reich des Glaubens ist geendet,
Zerstört die alte Herrlichkeit,
Die Schönheit weinend abgewendet,
So gnadenlos ist unsre Zeit.
O Einfalt, gut in frommen Herzen,
Du züchtig schöne Gottesbraut!
Dich schlugen sie mit frechen Scherzen,
Weil dir vor ihrer Klugheit graut.
Wo findst du nun ein Haus, vertrieben,
Wo man dir deine Wunder läßt,
Das treue Tun, das schöne Lieben,
Des Lebens fromm vergnüglich Fest?
Wo findest du den alten Garten
Dein Spielzeug, wunderbares Kind,
Der Sterne heil'ge Redensarten,
Das Morgenrot, den frischen Wind?
Wie hat die Sonne schön geschienen!
Nun ist so alt und schwach die Zeit;
Wie stehst so jung du unter ihnen,
Wie wird mein Herz mir stark und weit!
Der Dichter kann nicht mit verarmen;
Wenn alles um ihn her zerfällt,
Hebt ihn ein göttliches Erbarmen -
Der Dichter ist das Herz der Welt.
Den blöden Willen aller Wesen,
Im Irdischen des Herren Spur,
Soll er durch Liebeskraft erlösen
Der schöne Liebling der Natur.
Drum hat ihm Gott das Wort gegeben,
Das kühn das Dunkelste benennt,
Den frommen Ernst im reichen Leben,
Die Freudigkeit, die keiner kennt.
Da soll er singen frei auf Erden,
In Lust und Not auf Gott vertraun,
Daß aller Herzen freier werden,
Eratmend in die Klänge schaun.
Der Ehre sei er recht zum Horte,
Der Schande leucht er ins Gesicht!
Viel Wunderkraft ist in dem Worte,
Das hell aus reinem Herzen bricht.
Vor Eitelkeit soll er vor allen
Streng hüten sein unschuld'ges Herz,
Im Falschen nimmer sich gefallen,
Um eitel Witz und blanken Scherz.
Oh, laßt unedle Mühe fahren,
O klingelt, gleißt und spielet nicht
Mit Licht und Gnad, so ihr erfahren,
Zur Sünde macht ihr das Gedicht!
Den lieben Gott laß in dir walten,
Aus frischer Brust nur treulich sing!
Was wahr in dir wird sich gestalten,
Das andre ist erbärmlich Ding.-
Den Morgen seh ich ferne scheinen,
Die Ströme ziehn im grünen Grund,
Mir ist so wohl! - Die's ehrlich meinen,
Die grüß ich all aus Herzensgrund!
Eichendorff, Joseph von :: Gedichte | Sängerleben | An die Dichter
Totale Abgrenzung! Das, was obige Vergleichslisten vermuten ließen, hier wird's vollzogen. Auf der einen Seite die gnadenlose Zeit, vor deren Klugheit (sprich Rationalität) den Dichter graut, die Welt mit ihren frechen und blanken Scherzen, mit ihrem eitlen Witz usw. ist ihm zuwider; der Dichter dagegen erfreut sich Gottes Natur, bei ihm ist alles Einfalt, Wahrheit - kurz, er ist das Herz der Welt. So bewahrt man sich die Chimäre des Besonderen, die Aura des Eigentlichen, des Überzeitlichen - bei gleichzeitiger Beschwörung einer auserwählten Gefolgschaft (die es ehrlich meinen), die vermutlich für die ansonsten verachtete ökonomische Basis zu sorgen hat. Das Bild des Dichters, der in dunkler materialistisch verseuchter Zeit als Gralshüter der wahren Werte auftritt, umgeben von einer Schar ergebener Jünger, wird, ein halbes Jahrhundert nach Eichendorff, dann tatsächlich im George-Kreis Wirklichkeit und dieser sich selbst als elitär verstehende Kreis wirkt, wiederum hundert Jahre später, also heute, nicht nur wie eine verschrobene, aber harmlose Umsetzung romantischer Sehnsucht, sondern eher wie die (literarische) Probierstube für Führerkult und Fahneneid, die dann die bekannten verheerenden Folgen zeitigten.
Weltabgewandtheit und Überhöhung der dichterischen Existenz, nicht selten vermischt mit Weltschmerz und/oder vermeintlichem Sendungsauftrag, sind Merkmale eines Dichtertyps, den man als poeta vates, den Seher-Dichter kennt. (Allerdings dürfte Eichendorff kaum diesem Typus zuzurechnen sein, da es ihm nicht nur an Exzentrizität fehlt (ungleich Stefan George), sondern mehr noch an einer merkwürdigen Kategorie, die bei Interpreten und sog. Deutern von Poesie sich großer Beliebtheit erfreute, und vielleicht immer noch erfreut, - nämlich der Tiefe. Doch darüber ein andermal auf einem anderen Spaziergang)
Die Berührungsängste vor der banalen und bösen Welt, die sich nicht nur durch Eichendorffs dichterisches Werk ziehen, sind lediglich Ausdruck der Selbststilisierung dieser Weihrauch-Dichter. Andere, zum Beispiel Goethe, teilen sie nicht:
AN DIE GÜNSTIGEN
Dichter lieben nicht zu schweigen,
Wollen sich der Menge zeigen.
Lob und Tadel muß ja sein!
Niemand beichtet gern in Prosa;
Doch vertraun wir oft sub Rosa
In der Musen stillem Hain.
Was ich irrte, was ich strebte,
Was ich litt und was ich lebte,
Sind hier Blumen nur im Strauß;
Und das Alter wie die Jugend,
Und der Fehler wie die Tugend
Nimmt sich gut in Liedern aus.
Goethe, Johann Wolfgang von :: Gedichte. Erster Teil | Lieder | AN DIE GÜNSTIGEN
Sich dem Urteil der Menge auszusetzen, Lob und Tadel einzustecken, ja sogar zuzugeben, daß man sich geirrt haben könnte - das alles ist dem Romantiker Eichendorff vermutlich fremd und unzugänglich. An diesem kleinen Werk kann man ablesen, wie falsch jene Signatur als eines unnahbaren Olympiers ist, die die Gedankenlosigkeit Goethe verliehen hat. (Jene oft bemerkte und beschriebene kalte Unnahbarkeit, die er zur Schau trug, war wohl eher eine Schutzmaßnahme gegenüber den Handgreiflichkeiten seiner Bewunderer.) Der Weimarer “Dichterfürst” (wie ihn die gleiche Gedankenlosigkeit getauft hat) steht mit beiden Beinen in seiner Zeit, in der Wirklichkeit; Eichendorff wendet sich mit Grauen ab; Goethe hält bis zu seinem Ende seinem Prinzip der Tätigkeit die Treue; Eichendorff träumt sich eher in eine andere längst versunkene Welt.
Und paßt nicht Goethes ironischer Zweizeiler
Dichter gleichen Bären,
Die immer an eignen Pfoten zehren.
Goethe, Johann Wolfgang von :: Gedichte. Zweiter Teil | Sprichwörtlich | Zwei- und mehrzeilige Sprüche, über zweihundert
genau auf den Typus des weltabgewandten Poeten, der, wie Schiller es ausdrückt, “...zu den blauen Höhen entschwebt”?
Wie sich die Poesie zwischen Wirklichkeit und Phantasie plaziert (um bewußt das allzu gängige “verorten” der Literaturwissenschaftler zu vermeiden), je nach Dichter und der Zeit, in der er schreibt, ist ein Dauerthema dieser Spaziergänge. Aber zunächst zurück zu den Haupt-Wörtern.
Bevor wir uns der Entwicklung unserer Wortliste im di-lemmata-Zeitraum zuwenden, sei noch kurz ein gleichsam innerliterarischer Vergleich vorangestellt. Die Duden-Redaktion hat eine Häufigkeitsliste zur Verfügung gestellt, die sich auf den Wortschatz von Romanen beschränkt.
| Roman-Wortschatz (Duden-Korpus) |
poetischer Wortschatz (di-lemmata-Korpus) |
|
|---|---|---|
| 1 | Mann | Herz |
| 2 | Frau | Gott |
| 3 | Hand | Nacht |
| 4 | Auge | Auge |
| 5 | Tag | Leben |
| 6 | Zeit | Hand |
| 7 | Jahr | Liebe |
| 8 | Kopf | Tag |
| 9 | Mutter | Welt |
| 10 | Gesicht | Himmel |
| 11 | Vater | Kind |
| 12 | Kind | Erde |
| 13 | Blick | Seele |
| 14 | Leben | Mensch |
| 15 | Haus | Geist |
| 16 | Tür | Licht |
| 17 | Mensch | Zeit |
| 18 | Wort | Sonne |
| 19 | Stimme | Mann |
| 20 | Herr | Blick |
Die Gegenüberstellung zeigt, daß es zwar eine größere Übereinstimmung zwischen Prosa und Poesie bei den 20 häufigsten Lexemen gibt, aber auch in den Romanen fehlen jene Lexeme, wie Herz, Gott, Seele, die auf Innerlichkeit und Gefühl weisen. Auch dieser Vergleich bestärkt die Vermutung, daß wir es bei den genannten Wörtern mit einem spezifischen Wortschatz von Gedichten zu tun haben. Damit ist nicht gesagt, daß Wörter wie Herz, Gott und Seele allein auf die Poesie begrenzt sind – es sind selbstverständlich ganz gewöhnliche Allerweltswörter, wenn auch offensichtlich keine Wörter, die im Alltag ständig im Mund geführt werden; es besteht nur der Verdacht, daß diese Allerweltswörter, wenn sie in der Dichtung erscheinen, mit Bedeutung aufgeladen werden, sie verlieren, zumindest teilweise, ihren simplen Zeichencharakter. Wenn dies richtig ist, dann wird weiter zu fragen sein, ob Kommunikationsmodelle überhaupt auf die Poesie anwendbar sind, sprich: Gibt es einen “Code”, der vom Verfasser eines Gedichtes ver- und vom Leser entschlüsselt wird, wie in der Alltagskommunikation, oder liegt hier etwas ganz anderes vor? Trivial, werden einige sagen: Wenn der Chirurg über das Herz spricht, ist das “natürlich” etwas anderes, als wenn ein Dichter Herz auf Schmerz reimt. Gewiß – oder doch nicht?
O Herz, noch eine Weile halt aus
Mein Herz, wird sie noch reichen, die Kraft,
Die in dir schafft?
Das Haar will mir schon bleichen.
O Herz, noch eine Weile halt aus!
Bald glänzt das Ziel,
Dann deine Sorgen teile.
Zwei Herzen tragen viel.
Dauthendey, Max :: Gedichte | Des großen Krieges Not. | Lieder der Trennung | O Herz, noch eine Weile halt aus
Welches Herz ist hier Organ, welches Metapher?
Bisher wurde das di-lemmata-Korpus als eine Einheit genommen; es ist nun aber interessant zu sehen, wie sich die “poetischen Wörter” - wie wir sie behelfsmäßig nennen wollen - im Zeitraum von Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts “entwickeln”, das heißt, ob und wie sich die Reihenfolge der Lexeme verändert, denn es ist nicht anzunehmen, daß die Verteilung konstant bleibt. Hierfür werden Autoren zusammengenommen und nach den traditionellen Epochenbezeichnungen geordnet.
Die Übernahme der traditionellen Epochennamen bedeutet keine Zustimmung zu dieser Einteilung. Die Problematik jeder Epochengliederung ist allgemein bekannt und die Diskussion darüber (ähnlich der über einen Literaturkanon) ist end- und uferlos. Einigung ist nicht in Sicht, eine akademische Spielerei ohne weiteren Erkenntniswert. Der Setzung zum Beispiel einer Weimarer Klassik hätte schon Goethe widersprochen, der den Namen Klassik für die Antike reserviert sehen wollte und das Etikett “Realismus” oder auch “poetischer Realismus” legt als Abgrenzungskriterium nahe, daß Autoren, die nicht dazu gezählt werden, unrealistisch gewesen seien usw. Am ehesten noch, will mir scheinen, haben die Bezeichnungen “Romantik” und “Expressionismus” etwas für sich, da sie sich historisch einigermaßen genau fixieren lassen (zumindest ihr Beginn) und sich auch programmatisch verstanden (Stichworte: Friedrich Schlegel und sein Kreis in Jena; Jakob von Hoddis' Gedicht Weltende), wenn man auch hier einschränkend hinzufügen muß, daß beide “Epochen” (wie alle anderen auch) - eingebettet in einen historischen Kontext - nicht ex cathedra entstanden sind, sondern schon vorhandene Tendenzen fortsetzen. Übergänge sind fließend, oft unmerklich und haben selten den Charakter der Gegensätzlichkeit, sondern eher der Vereinnahmung oder Fortschreibung. Die Literatur ist viel konstanter, als das manche Theorien nahelegen. Meiner Ansicht nach liegen die “wirklichen” Brüche in der viel zu wenig beachteten Geschichte der Naturwissenschaften und Technologie.
Trotz dieser Einwände halte ich hier in einem heuristischen Sinne an der Einteilung in Epochen fest, zum einen, weil literarisch Interessierte an sie von Schulzeiten an gewohnt sind und zum anderen, weil den Autoren der jeweiligen “Epoche” immerhin die biographische Zeitgenossenschaft eignet (aber auch hier wäre einzuwenden, daß auch dieses Kriterium nicht eindeutig ist, da zum Beispiel Goethes Leben sich über drei sog. Epochen erstreckt).
Vorbehaltlich des Gesagten also folgende Einteilung:
- Weimarer Klassik (Goethe, Schiller)
- Romantik (Arnim, Tieck, Eichendorff, Schulze, Schlegel, Schwab, Uhland)
- “Realismus” (Hebbel, Meyer, Keller, Storm, Heyse)
- “Symbolismus” (Dauthendey, Hofmannsthal, Rilke)
- Expressionismus (Heym, Trakl, Boldt, Lotz, Lichtenstein, Stadler)
Für die jeweils 20 häufigsten Substantive dieser Zeitabschnitte ergibt sich folgende Übersicht:
| Gesamt | Klassik | Romantik | Realismus | Symbolismus | Expressionismus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herz | Gott | Herz | Herz | Nacht | Nacht |
| 2 | Gott | Herz | Liebe | Auge | Herz | Hand |
| 3 | Nacht | Leben | Leben | Hand | Hand | Wind |
| 4 | Auge | Liebe | Gott | Leben | Auge | Himmel |
| 5 | Leben | Tag | Nacht | Kind | Leben | Auge |
| 6 | Hand | Welt | Auge | Tag | Tag | Licht |
| 7 | Liebe | Freund | Welt | Welt | Erde | Abend |
| 8 | Tag | Mensch | Wald | Nacht | Haus | Schatten |
| 9 | Welt | Auge | Blick | Gott | Himmel | Tag |
| 10 | Himmel | Kind | Geist | Haus | Baum | Wald |
| 11 | Kind | Blick | Hand | Zeit | Welt | Meer |
| 12 | Erde | Mann | Himmel | Mann | Weg | Wolke |
| 13 | Seele | Geist | Lust | Liebe | Sonne | Herz |
| 14 | Mensch | Himmel | Kind | Herr | Kind | Baum |
| 15 | Geist | Hand | Brust | Sonne | Wind | Dunkel |
| 16 | Licht | Glück | Lied | Himmel | Gott | Blut |
| 17 | Zeit | Natur | Land | Wort | Ding | Sonne |
| 18 | Sonne | Wort | Blume | Seele | Frau | Stern |
| 19 | Mann | Zeit | Licht | Traum | Mensch | Tod |
| 20 | Blick | Freude | Zeit | Tod | Blut | Traum |
Betrachtet man in diesem Vergleich die drei Kernwörter der Dichtung zwischen Klassik und Expressionismus, so zeigen sich signifikante Unterschiede, die schon an der sprachlichen Oberfläche auf die sehr unterschiedlichen Einstellungen der jeweiligen Epochen hinweisen. Während in der Weimarer Klassik die meist negativ assoziierte Nacht fehlt, erscheint sie im Expressionismus an erster Stelle, noch dazu ergänzt von Dunkel und Schatten. Umgekehrt findet sich bei Goethe und Schiller unter den zwanzig häufigsten Substantiven kein Lemma, dem man ad hoc eine negative Bedeutung beilegte. Dagegen erscheinen hier (und nur hier!) die positiv besetzten Begriffe Freund, Freude und Glück.
Ebenfalls ins Auge fällt der allmähliche Abstieg Gottes (salopp formuliert) im Laufe des 19. Jahrhunderts, was allerdings, wie ich vermute, mit der Veränderung des Bildungshintergrunds zu tun haben wird. Die Präsenz, das heißt die Kenntnis der antiken Mythologie geht deutlich zurück; man baut nicht mehr oder nicht mehr so häufig auf die vielfältige Symbolik der antiken Götter- und Heldenwelt, die dem lesenden Publikum um 1800 zumindest in großen Teilen geläufig war. Darüber können auch Rilkes Sonette an Orpheus nicht hinwegtäuschen (bei denen ohnehin die Frage ist, wieweit sie überhaupt dem klassischen Orpheus-Mythos verpflichtet sind).
Nichtsdestoweniger scheint das Abstraktum Gott, gleichsam als eine metaphysische Entität, die für Zeitloses, Ewiges, Übernatürliches steht und auch zuweilen der durchaus christlich verstandene Gott, selbst noch im Expressionismus eine gewichtige Rolle für die Dichter zu spielen (auch wenn das Lexem selbst nicht mehr unter den zwanzig häufigsten vertreten ist); man denke nur an Trakl, der neben Rilke, und Morgenstern zu den “Gottsuchern” unter den Poeten gezählt werden darf. Aber mit Gott und Göttern beschäftigt sich der nächste Spaziergang und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich für heute, in der Hoffnung, daß Friedrich Rückert Recht behält:
Wiedersehn ist ein schönes Wort,
Ist es nicht hier, so ist es dort:
Sei es nun dort oder hier,
Auf Wiedersehn scheiden wir.
Rückert, Friedrich :: Gedichte | Pantheon | Fünftes Bruchstück. Zahme Xenien | Vierzeilen