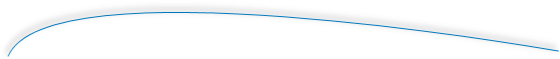Spaziergänge durch poetische Wälder
Zum Wortschatz der Poeten
von Lessing bis Heym
von Lessing bis Heym
Zur Vorbereitung
1. Grundsätzliche Fragen ohne Antwort
Was ist Literatur? Was ist Dichtung? Was ist ein Gedicht? Grundsätzliche Fragen, die an germanistischen Seminaren, möglicherweise an höheren Bildungsanstalten, vielleicht sogar im Feuilleton gestellt und beantwortet werden. Beantwortet? Der Antworten gibt es viele, eine lautet z. B.:
Als Gedicht ist grundsätzlich jeder Text zu bezeichnen, der - im Unterschied zur Prosa - ganz oder teilweise aus Versen besteht. Als Verse sind dabei nicht nur metrisch gebundene, sondern auch Freie Verse zu verstehen. Typische, aber nicht notwendige Merkmale von Gedichten insbesondere vor dem 20. Jh. sind Reimbindung und strophische Gliederung. Die vor allem im 20. Jh. häufige Identifikation des Gedichts mit dem 'lyrischen Gedicht' [...] greift zu kurz. Gedichte sind nicht notwendig (wenngleich häufig) lyrisch, sie können z. B. auch dramatisch oder episch strukturiert sein.
Lamping, Dieter: Art. “Gedicht”, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, hrsg. von Klaus Weimar, Berlin u. New York 1997, S. 669.
Aha, könnte man sagen, oder auch o weh.
“ganz oder teilweise”,
“nicht nur ... sondern auch”,
“typische, aber nicht notwendige”,
“greift zu kurz”,
“nicht notwendig ...können auch”.
Offensichtlich kann der Verfasser sich nicht so recht festlegen und es versteht sich wohl von selbst, daß der Gebrauchswert einer solch vagen Begriffserklärung eher bescheiden ausfällt. Freilich ist es mehr als fraglich, ob man überhaupt adäquat beschreiben oder gar erklären kann, was ein Gedicht (“eigentlich”) sei. Unter den “Gedicht-Definitionen” haftet wahrscheinlich die salopp humorvolle am längsten im Gedächtnis, nach der ein Gedicht das ist, wo rechts noch Platz ist.
Aber brauchen wir (abseits der literaturwissenschaftlichen Seminare) überhaupt eine Erklärung oder gar eine Definition dessen, was ein Gedicht ist? Was ein Gedicht ist, wissen wir nämlich schon immer, nämlich immer dann, wenn wir in der Praxis sagen: Das ist ein Gedicht.
Jeder Leser, der Rilkes Sonette an Orpheus zur Hand nimmt, ist sich selbstredend darüber im Klaren, daß er Gedichte liest und nicht die Börsennachrichten und kaum jemand wird ein Rezept für eine Spargelcremesuppe mit einem Naturgedicht verwechseln. Die Frage nach einer Definition des Gedichts ist eine bloß theoretische, und in der lebensweltlichen Praxis spielen die theoretischen Überlegungen eine weit geringere Rolle, als die Theoretiker ahnen (wobei noch hinzugefügt werden kann, daß sich bei den sog. Geisteswissenschaften die Theorie nicht selten vor der Praxis blamiert).
Und die Dichter selbst? Sollten sie nicht wissen, was ein Gedicht ist, so wie ein Automechaniker (hoffentlich) weiß, was ein Auto ist. Hier – als Kontrastprogramm sozusagen – zwei gereimte Antworten.
Poesie
Frägst du mich im Rätselspiele,
Wer die zarte lichte Fei,
Die sich drei Kleinoden gleiche
Und ein Strahl doch selber sei?
Ob ich's rate? Ob ich fehle?
Liebchen, pfiffig war ich nie,
Doch in meiner tiefsten Seele
Hallt es: Das ist Poesie!
Jener Strahl der, Licht und Flamme,
Keiner Farbe zugetan,
Und doch, über alles gleitend
Tausend Farben zündet an,
Jedes Recht und keines Eigen. -
Die Kleinode nenn' ich dir:
Den Türkis, den Amethysten,
Und der Perle edle Zier.
Poesie gleicht dem Türkise,
Dessen frommes Auge bricht,
Wenn verborgner Säure Brodem
Nahte seinem reinen Licht;
Dessen Ursprung keiner kündet,
Der wie Himmelsgabe kam,
Und des Himmels milde Bläue
Sich zum milden Zeichen nahm.
Und sie gleicht dem Amethysten,
Der sein veilchenblau Gewand
Läßt zu schnödem Grau erblassen
An des Ungetreuen Hand;
Der, gemeinen Götzen frönend,
Sinkt zu niedren Steines Art,
Und nur einer Flamme dienend
Seinen edlen Glanz bewahrt;
Gleicht der Perle auch, der zarten,
Am Gesunden tauig klar,
Aber saugend, was da Krankes
In geheimsten Adern war;
Sahst du niemals ihre Schimmer
Grünlich, wie ein modernd Tuch?
Eine Perle bleibt es immer,
Aber die ein Siecher trug.
Und du lächelst meiner Lösung,
Flüsterst wie ein Widerhall:
Poesie gleicht dem Pokale
Aus venedischem Kristall;
Gift hinein - und schwirrend singt er
Schwanenliedes Melodie,
Dann in tausend Trümmer klirrend,
Und hin ist die Poesie!
Annette von Droste-Hülshoff
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein,
Da ist alles dunkel und düster;
Und so sieht's auch der Herr Philister:
Der mag denn wohl verdrießlich sein
Und lebenslang verdrießlich bleiben.
Kommt aber nur einmal herein,
Begrüßt die heilige Kapelle;
Da ist's auf einmal farbig helle,
Geschicht' und Zierat glänzt in Schnelle,
Bedeutend wirkt ein edler Schein;
Dies wird euch Kindern Gottes taugen,
Erbaut euch und ergetzt die Augen!
Johann Wolfgang von Goethe
Was ein Gedicht oder gar die Poesie sei, wissen wir nach der Lektüre der beiden Werke auch nicht, haben aber immerhin zwei Texte gelesen, die wir für Gedichte halten! Die Frage nun, die für uns bei weitem interessanter als die nach einer Definition des Gedichts ist, ist die: Wie haben wir die beiden Texte, die wir zurecht für Gedichte nehmen, gelesen? Haben wir beim Lesen der beiden Gedichte eine andere (Geistes-)Haltung eingenommen als beim Studium einer Ikea-Gebrauchanweisung oder bei einem Leitartikel zur gerade gängigen Krise? Oder sind wir bei der Lektüre einer andern Sprache als der currenten Alltagssprache begegnet? Kurz, die Frage, die uns zu unseren Spaziergängen durch poetische Wälder veranlaßt, ist die nach dem Wortschatz der Poeten, nach der poetischen Sprache, und nach den Folgen, die die poetische Sprache, wenn es sie denn gibt, für den Leser, also für uns happy few, hat oder haben könnte.
2. Die poetische Sprache
In den Schriften “Zur Naturwissenschaft” schreibt Goethe unter dem Abschnitt “Symbolik”:
Durch Worte sprechen wir weder die Gegenstände noch uns selbst völlig aus. Durch die Sprache entsteht gleichsam eine neue Welt, die aus Notwendigem und Zufälligem besteht. Verba valent sicut nummi. Aber es ist ein Unterschied unter dem Gelde. Es gibt goldne, silberne, kupferne Münzen und auch Papiergeld. In den erstern ist mehr oder weniger Realität, in dem letzten nur Konvention. Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig fort, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tiefern Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andre Sprache ein, die poetische.
Weimarer Ausgabe, Bd. 75, S. 167
Obwohl das Thema die poetische Sprache ist, möchte ich an dieser Stelle einige Bemerkungen zur Literatur-Rezeption, wie sie sich vor allem im 19. Jahrhundert meines Erachtens nach in Deutschland entwickelt, einflechten.
Mit der dichotomischen Denkweise, hier von Oberflächlichkeit (Alltag) und Tiefe (Poesie), steht der Doyen der deutschen Literatur ganz in der Tradition des europäischen Denkens von Platon her. Antagonistische, dialektische Gedankenfiguren durchziehen dieses Denken und tauchen immer wieder in Abwandlungen und verschiedenen Gestalten auf: Leib - Seele bei Descartes; Wesen und Erscheinung bei Kant; These und Antithese bei Hegel; naive und sentimentale Dichtung bei Schiller; das Apollinische und Dionysische bei Nietzsche; Basis und Überbau bei Marx bis zu den Niederungen der Trivialität und des Sentiments, das in einem Stoßseufzer von Sein und Schein spricht.
Offenbar kommt der theoretische Diskurs ohne Abgrenzung und dialektische Turnübungen nicht aus. Über Sinn und Brauchbarkeit mancher solcher Begriffspaare lassen sich vielfältige Betrachtungen anstellen, bei einigen mag der Unterhaltungs- vermutlich höher als der Erkenntniswert liegen. Trotzdem, so denke ich, zeitigte die Gegenüberstellung von trivialem Alltag und “tiefer” Poesie, die Goethe hier vornimmt, durchaus Folgen, die weit über den Rahmen autistischer Seminar-Diskurse hinausgehen.
Der Alltag, das heißt, das mehr oder minder fremdbestimmte Leben in einer anachronistischen hierarchisch und bis in die Winkel hinein autoritären Feudalgesellschaft, wird, wenn auch mit dem schlechten Gewissen, das dem Opportunisten eignet, als minderwertig und vor allem als unecht desavouiert und ihm wird, verschroben genug, ein “wahres” Leben gegenüberstellt, das sich vornehmlich in der Produktion und Rezeption von Kunst im weiteren Sinne offenbare, welches sich, wie z. Bsp. bei Schopenhauer, geradezu zu einem Erlösungssyndrom steigert. In diesem Prozeß individueller und gesellschaftlicher Verdrängung (verstärkt durch das klägliche Scheitern der “Revolutions”versuche von 1848) wird das ars longa vita brevis vom deutschen Bildungsbürgertum so umgedeutet, daß die Kunst fürs “Wahre”, “Eigentliche”, “Ewige” zuständig ist (gebündelt im sog. Kulturleben, das als Nischendasein die Frustration der Beteiligten vermutlich noch erhöhte) und das profane “Leben” fürs Vegetative, ja Animalische steht. Nur indem das Bürgertum mittels dieser falschen Alternative beharrlich seine politische Impotenz und seine romantisch verbrämte Innerlichkeit als eine dem “Eigentlichen” zugewandte weltanschauliche Tugend ausgeben kann, gelingt es ihm, die von ihm mit zu verantwortenden Katastrophen des 20. Jahrhunderts einigermaßen schadlos zu überstehen.
Anmerkung: »Beispielhaft die Praxis von Iphigenie-Aufführungen: Dergestalt als deutsches 'Seelendrama' und Humanitäts-Festspiel zugerichtet, wurde der Text ungeniert über sämtliche Bühnen gezerrt. Die traurige Linie reicht von der Festaufführung zur Hochzeit des Erzherzogs Joseph 1800 in Wien bis zur “schauerlichen Parodie: der kaiserliche Herr - Wilhelm II., 1917 - eröffnet höchstpersönlich das Theater der deutschen Truppen in Lille mit Goethes Iphigenie” (Minder, S. 40). Es sollte noch schlimmer kommen: Boguslaw Drewniak berichtet von Aufführungen des Stückes zur Zeit des unseligen 'Generalgouvernements' “im Sommertheater des Lazienki-Parkes” in Warschau 1940 (Drewniak, S. 105). Ebenso deplaziert mußte eine Aufführung im besetzten Frankreich wirken. “Auf Veranlassung des Reichspropagandaministeriums zeigte am 14. und 15. April 1942 mit großer Reklame eine Theatergruppe des Münchner Schauspielhauses in der Comédie Franaise Goethes Iphigenie auf Tauris” (Drewniak, S. 115)! Robert Minder hat den Vorgang richtig eingestuft: “Iphigenie als Gehilfin am Feuerofen” (Minder, S. 40). Die Linie peinlicher Alibi-Inszenierungen setzt sich fort in den nach 1945 allenthalben zelebrierten theatralischen Bekundungen 'wiedergefundener Humanität'. Diese Iphigenie gehört endgültig auf den Friedhof geschändeter Rezeptionsleichen.«
Theo Buck, Goethe als Dramatiker, in: Goethe-Handbuch, Bd. 2, S. 1-20
Zurück zu Goethes Konzept einer poetischen Sprache. Wird im vorgestellten Auszug nur die Existenz einer poetischen Sprache konstatiert (als für “tiefere Verhältnisse” zuständige), ohne daß Goethe sich näher auf den Begriff einläßt, so legt er in seinen Maximen und Reflexionen seine Auffassung von Symbolik vor:
Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe. / Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, dass der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei. / [...] Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. Wer nun das Besondere lebendig fasst, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät.
Hamburger Ausgabe: Maximen und Reflexionen 749-751; Hervorhebungen von mir.
Goethes Denken in Sachen Poesie zielt auf das Symbolische; das Symbolische ist der Schlüsselbegriff seiner, wenn man so will, Poetik. Und doch scheint das Symbolische, die Symbolik etwas (wenn wir denn Goethe beim Worte nehmen) Nicht-greifbares, Unaussprechliches zu bleiben; es ist etwas, das die eigentliche Natur der Poesie ausmacht, aber doch “selbst in allen Sprachen ... unaussprechlich” bleibt.
Offensichtlich liegt das “Symbolische” nicht in den Wörtern oder den Sätzen, ist also nicht etwas, das wie das Eisen aus dem Erz nur herausgebrochen werden muß, um es zu gewinnen. Aber welchen Sinn hätte es dann, eine poetische Sprache zu konstatieren, die mittels Symbolik jene tieferen Verhältnisse auszudrücken vermag; einer Symbolik, die dann doch wieder nicht zu greifen ist, offenbar selbst in der poetischen Sprache nicht. Folglich ist das Symbolische etwas Sprachexternes, das der Dichter qua Intention (früher und vielleicht heute immer noch: qua Intuition) in den Text hineingelegt hat, und der Leser per lebendigem Erfassen erkennt, ohne es gewahr zu werden. Aber wie ist dann das Verhältnis zwischen poetischer Sprache und einer Symbolik, die außerhalb der poetischen Sprache “existiert” oder “wirkt”? Es muß ja doch wohl eine Wechselwirkung zwischen poetischer Sprache und Symbolik bestehen; denn offenbar ist die alltägliche Sprache gerade nicht symbolisch; sie ist profanes Mittel der Kommunikation. (Ähnliches meint wohl der Sprachwissenschaftler Jakobsen, wenn er sagt, daß in der Poesie das Wort nicht Mittel, sondern Zweck sei.) Folglich hat die Symbolik, zumindest indirekt, etwas mit der Sprache, die sich als eine poetische versteht, zu tun. Aber kann zum Beispiel ein bestimmtes Wort per se symbolisch sein, so daß wir einen Anhaltspunkt für die Poetizität eines Textes erhalten? Oder ist das Symbolische etwas, was von einem Text insgesamt inauguriert wird, ohne im Text selbst zu erscheinen, also etwas, was zwischen den Zeilen steht, etwas Vages, etwas, das zwischen den Bedeutungen, die einem Wort beigelegt werden, vibriert vielleicht, vielleicht schwebt, eben etwas, was nicht auf einen Begriff gebracht werden kann, das heißt ins “Nicht-Symbolische” übersetzt, rückübersetzt werden kann - oder nur darf?
Zerstört der Stich ins Symbolische - wenn er denn möglich wäre -, also die Auflösung ins Nicht-Symbolische, jene Aura, die die Poesie umgibt, als hätte sie es gerade - und manche glauben nur sie - allein mit dem zu schaffen, was sich jeder Profanität entzieht. Oder kann man gerade das Symbolische an den Erzeugnissen der Poesie nicht zerstören, nicht zerlegen, ohne das Produkt selbst zu zerstören? Und was ergäbe dann ein solch destruktiver Akt? Eine Erklärung - aber wofür? (Nebenbei: Das Bedürfnis nach Erklärung, nach Auflösung des scheinbar (oder doch wirklich?) Inkommensurablen ist seit romantischen Zeiten institutionalisiert (an Universität und Schule) und weit gefächert in jenem ausgedehnten Raum, den man als Feuilleton fassen könnte.)
Bevor man in einem Sumpf von Fragen versinkt, die nicht selten Mystisches und Irrationales streifen und zu Glaubens- und Überzeugungssachen zu verkümmern drohen, sollte man versuchen, einigermaßen sicheren Boden zu gewinnen, indem man zunächst (vielleicht) beantwortbare Fragen stellt.
Hinsichtlich der goetheschen Konzeption von Symbol frage ich deshalb, einfach und schlicht: Wann ist oder wird ein Wort oder ein Satz symbolisch?
Einige Sätze:
a) Über allen Gipfeln ist Ruh
b) Der Gipfel war erreicht, die Sohlen brannten
c) Viele Griechen haben das zu Recht als den Gipfel ihrer Entmündigung empfunden.
d) Auch von des höchsten Gebirgs beeisten, zackigen Gipfeln schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
e) Das meiste dessen ich persönlich fähig war hab ich auf den Gipfel des Glücks gebracht, oder sehe vor mir es wird werden.
f) Hier lieg ich, mich dünkt es der Gipfel der Welt,
g) Das ist aber auch schon der Gipfel der Gemeinsamkeiten
h) Auch rat ich dir, baue dein Hüttchen im Tal und nicht auf dem Gipfel.
usw.
Welcher dieser Sätze oder welcher dieser Gipfel meint nun “tiefere Verhältnisse”, weist als Symbol über sich hinaus, oder verwandelt, um Goethes Auffassung anzulegen, “die Erscheinung in eine Idee und die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im Bild unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe”.
Ja, gewiß: Über allen Gipfeln ist Ruh ... Aber liegt der Grund für das Symbolische, das Poetische an dem Satz (und mithin am Wort Gipfel) nicht allein darin, daß wir den Satz als Beginn eines berühmten Gedichtes bereits kennen! Auch die Sätze unter b, d, f und h sind Zitate aus Gedichten (und der geneigte Leser dieser Zeilen, mag aufgemuntert sein, sie mit Hilfe des di-lemmata-Programms zu finden); nur haben sie nicht den Bekanntheitsgrad von a. Vielleicht, so mein Verdacht, ist das Symbolische, also das Poetische an der Poesie, nur indirekt eine Sache der Gedichte und Verse, der Sätze, Phrasen und Wörter, sondern vielmehr eine Art Vorstellungskonglomerat, in dem sich Gefühle, höherer Natur, versteht sich, Irrationalismen, Idiosynkrasien, tradierte Ideologeme, Bildungsbestände, Vorurteile, Faktenwissen, Moden usw. zu einem Habitus vereinigen, der anläßlich einer Gedicht-Rezeption (sprich Gedicht-Interpretation) vor- oder aufgeführt wird. Das Poetische an der poetischen Sprache ist, vielleicht, etwas, das im Augenblick, in dem man das Spielfeld Poesie betritt, an die Sprache der Dichtung herangetragen, möglicherweise ihr übergestülpt wird oder sie gar zudeckt und unkenntlich macht. Oder einfacher: ein Gedicht (sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption) setzt das Sprachspiel Poesie in Gang; ein Sprachspiel, dessen Regeln, wiederum vielleicht, zumindest grosso modo durch die Lebenswelt (Tradition etc.) festgelegt sind, dessen einzelne Spielzüge jedoch im Rahmen eines Fairplay frei sind.
Und die Texte, die Gedichte? Wären sie, wenn die Analyse auch nur halbwegs recht hat, lediglich ein beliebiger Anlaß, ein Spiel in Gang zu setzen; hätten sie also nichts mit dem Poetischen zu tun? Offenbar nicht, denn wenn dem so wäre, dann wäre der Text des Gedichtes vollkommen gleichgültig; jeder Text, der zu einem Gedicht ernannt wird, hätte dann im jeweiligen Rezipienten die gleichen Folgen. Die Widersinnigkeit dieser Annahme erweist schon die eigne Erfahrung; denn jeder, der sich auf das Spiel der Poesie einläßt, freiwillig und willig einläßt, also nicht wie die Sklaven, die zu sog. Interpretationen gezwungen werden, weiß, daß das poetische Spiel bei Goethe einen anderen Verlauf nimmt als bei Rilke, Brecht oder Trakl.
Die Lage ist vertrackt: kontextfreie Wörter und Sätze sind an sich selbst wohl selten, vermutlich nie, symbolisch, will sagen, per se poetisch; erst gewisse Umstände (nämlich die Praxis des Spiels Poesie) verwandeln sie in eine poetische Sprache, ohne daß man, zumindest nach Goethe, dieses Poetische, dieses Symbolische erfassen und aussprechen könnte.
Und doch besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen den Wörtern und Sätzen, Versen und Reimen, kurz zwischen dem so und so geordneten Wortmaterial und dem Poetischen, dem Symbolischen, meintethalben auch dem Ästhetischen. Zwar wissen wir noch nicht, was die Poetizität eines Gedichtes ausmacht, aber immerhin haben wir die ganz realen Wörter und Sätze des Gedichts, die das Spiel der Poesie in Gang setzen.
Sie gilt es auf einem ersten Spaziergang durch die poetischen Wälder ins Auge zu fassen.
Und so sagt schon Baudelaire:
Je lis dans un critique : »Pour deviner l'âme d'un poëte, ou du moins sa principale préoccupation, cherchons dans ses œuvres quel est le mot ou quels sont les mots qui s'y représentent avec le plus de fréquence. Le mot traduira l'obsession.«
(»Um die Seele eines Dichters zu durchschauen oder zumindest jedoch das, womit er sich hauptsächlich beschäftigt, muß man in seinem Werk das Wort oder die Worte suchen, die am häufigsten vorkommen. Das Wort verrät, wovon er besessen ist.«)
Charles Baudelaire, Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, S. 368
Bevor wir uns also auf den Weg machen, seien noch einige Voraussetzungen genannt, die sich nach dem bereits Dargelegten fast von selbst verstehen.
Wörter und Sätze haben eine “Bedeutung”. Den sofortigen Einwurf, daß das nicht stimme, wehren wir ab und veranschlagen die berühmten und unberühmten Beispiele von poetischen Texten, die ohne Wörter auskommen als eine quantité negliable, als die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. (Die interessante Frage, ob nicht gewisse Lautgedichte, z.B. die Ernst Jandls, nicht doch noch eine Semantik oder “semantische Reste” mit sich führen, bleibt hier ohne Beachtung, zumal dessen Werk auch nicht in dem hier bearbeiteten Zeitraum liegt.)
Wir gehen also davon aus und halten daran fest, daß jedes Wort mindestens eine, meist aber mehrere “Bedeutungen” hat, daß diese Bedeutungen aber keineswegs fest sind, sie bewegen sich, ähnlich den Planeten, Kometen und Asteroiden, die in unterschiedlicher Größe und Dauer um eine Sonne kreisen, um ein allerdings leeres Zentrum; denn das Wesen einer Sache, eines Wortes, eines Begriffs gibt es nicht. Unter jedes Wort kann ein Bedeutungscluster subsumiert werden, das seinerseits selbstverständlich ebenfalls nicht fest ist; eher pulsierend. Dieses unfeste, sich dauernd, wenn auch nur minimal, ändernde Bedeutungscluster entstand und entsteht in einem historisch lebensweltlichen Kontext, in dem Individuen einer Sprachgemeinschaft diese Sprache teilen. Von diesem Bedeutungscluster kann man nicht (jedenfalls nicht gänzlich) abstrahieren, man kann es nicht “wegdenken”, man kann es nicht “auslöschen”; dieser sich stets bewegende Bedeutungscluster ist den Wörtern inhärent; er verändert sich, wird größer, wird kleiner, verschiebt sich, verliert Planeten und Kometen, fängt neue ein, ist nicht auf den Begriff zu bringen, an ihm scheitern alle Definitionen (oder die Definitionen werden selbst nur zu einem Bestandteil des Clusters).
Jedem sei unbenommen, in Freiheit und nach geistigem Vermögen diesem semantischen Sammelsurium etwas hinzuzufügen, oder etwas wegzustehlen und so mag Adorno (siehe unten: Anhang) in der Kopula “sein” das Nicht-Identische lesen (die, die seiner Philosophie anhängen oder auch nachdenken werden ihm möglicherweise zustimmen; andere gehen andere Wege und lesen die Kopula als Kopula und die Sonate als ein Musikstück).
Ein letztes Wort noch zu einer Frage, die dem Leser, der bis hierher durchgehalten hat, vielleicht auf der Zunge liegt. Warum dieser ganze Aufwand? Warum nur will man durch poetische Wälder spazierengehen? Statt zum Beispiel Geld zu verdienen, ins Kino zu gehen oder nach Hawai zu fahren.
Nun, weil es Vergnügen bereitet – oder warum sonst...?
Anhang
1. Wie man poetische Sprache verstehen kann: zwei sehr unterschiedliche Beispiele
Die beiden Textstellen werden hier, nur kurz kommentiert, gegenübergestellt, weil sie die ganze Bandbreite dessen zeigen, was man Lesartenpluralismus nennt.
a) Die hohe Kunst der Negation - Adorno
Hier leuchtet die ganze Problematik der Analyse poetischer Sprache wie in nuce auf. Theodor W. Adorno schreibt in Bezug auf ein Trakl-Gedicht, ausgehend von seiner Auffassung des “autonomen Kunstwerkes”, folgendes:
Die gescholtene Unverständlichkeit der hermetischen Kunstwerke ist das Bekenntnis des Rätselcharakters aller Kunst. An der Wut darüber hat teil, daß solche Werke die Verständlichkeit auch der traditionellen erschüttern. Allgemein gilt, daß die von Tradition und öffentlicher Meinung als verstanden approbierten unter ihrer galvanischen Schicht sich in sich zurückziehen und vollends unverständlich werden; die manifest unverständlichen, die ihren Rätselcharakter unterstreichen, sind potentiell noch die verständlichsten. Der Begriff fehlt der Kunst strengen Sinnes auch dort, wo sie Begriffe verwendet und an der Fassade dem Verständnis sich adaptiert. Keiner geht in das Kunstwerk ein als das, was er ist, ein jeder wird so abgewandelt, daß sein eigener Umfang davon betroffen, die Bedeutung umfunktioniert werden kann. Das Wort Sonate in Gedichten Trakls empfängt einen Stellenwert, der ihm nur hier, mit seinem Klang und den vom Gedicht gelenkten Assoziationen zukommt; wollte man unter den diffusen Klängen, die suggeriert werden, eine bestimmte Sonate sich vorstellen, so wäre ebenso verfehlt, was das Wort im Gedicht will, wie die beschworene imago einer solchen Sonate und der Sonatenform überhaupt unangemessen wäre. Gleichwohl ist es legitim, denn es bildet sich an Bruchstücken, Fetzen von Sonaten, und deren Name selbst erinnert an den Klang, der gemeint ist und im Werk erweckt wird. Der Terminus Sonate geht auf hochartikulierte, motivisch-thematisch gearbeitete, in sich dynamische Gebilde, deren Einheit eine von deutlich unterschiedenem Mannigfaltigen ist, mit Durchführung und Reprise. Die Zeile »Es sind Zimmer, erfüllt von Akkorden und Sonaten« führt davon wenig mehr mit sich, dafür jedoch das Kindergefühl bei der Nennung des Namens; sie hat mehr mit dem falschen Titel Mondscheinsonate zu tun als mit der Komposition und ist doch kein Zufälliges; ohne die Sonaten, welche die Schwester spielte, wären nicht die abgeschiedenen Laute, in denen die Schwermut des Dichters Unterschlupf sucht. Etwas dergleichen haben im Gedicht noch die einfachsten Worte, die es der kommunikativen Rede entlehnt; daher zielt Brechts Kritik an autonomer Kunst daneben, sie wiederhole einfach, was eine Sache ohnehin sei. Noch die bei Trakl omnipräsente Copula ›ist‹ entfremdet im Kunstwerk sich ihrem begrifflichen Sinn: sie drückt kein Existentialurteil aus sondern dessen verblaßtes, qualitativ bis zur Negation verändertes Nachbild; daß etwas sei, ist darin weniger und mehr, führt mit sich, daß es nicht sei. Wo Brecht oder Carlos Williams im Gedicht das Poetische sabotieren und es dem Bericht über bloße Empirie annähern, wird es keineswegs zu einem solchen: indem sie polemisch den erhoben lyrischen Ton verschmähen, nehmen die empirischen Sätze bei ihrem Transport in die ästhetische Monade durch den Kontrast zu dieser ein Verschiedenes an. Das Gesangsfeindliche des Tons und die Verfremdung der erbeuteten Fakten sind zwei Seiten desselben Sachverhalts. Verwandlung widerfährt im Kunstwerk auch dem Urteil. Diesem sind die Kunstwerke analog als Synthesis; sie jedoch ist in ihnen urteilslos, von keinem ließe sich angeben, was es urteilt, keines ist eine sogenannte Aussage. Dadurch wird fraglich, ob Kunstwerke überhaupt engagiert sein können, selbst wo sie ihr Engagement hervorkehren. Wozu sie sich verbinden, woran sie ihre Einheit haben, ist auf kein Urteil zu bringen, auch nicht auf das, welches sie selbst in Worten und Sätzen fällen.
Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften, Band 7, S. 186 f.
Das Lexem Sonate hat - nach Adorno - in den Texten Trakls nicht die Bedeutung “Sonate”, sondern erweckt allenfalls das Kindergefühl bei der Erinnerung an eine Sonate; die Kopula “ist” ist kein Existentialurteil, ja überhaupt keine Aussage, sondern eher ein Negatives, ein “Nicht - ist”. Das Gedicht, kurz, sagt nichts aus. Und daß es nichts aussagt, ist sein “Poetisches”. Und daher hat ein Gedicht (wie jedes gelungene Kunstwerk) für Adorno und seine Adepten des autonomen Werkes keine Botschaft, kann sich nicht engagieren, selbst wenn es die Absicht hat, sich zu engagieren. Sein “Gehalt” aber bleibt bestehen, eben das Poetische, daß sich nicht auf den Begriff bringen läßt. Und wir sind wieder bei Goethes Symbol, bei der Inkommensurabilität der Kunst. Offenbar ist ein Gedicht etwas merkwürdig Flimmerndes, ein flackerndes Irrlicht, etwas Sich-Entziehendes, etwas von dem man nicht sagen kann, was es eigentlich ist. Und das Material des Gedichts - die Wörter und Sätze - sind ... sind was? Offensichtlich nicht das, was sie in der profanen Kommunikation angeblich sind, erklärbare Zeichen in einem erklärbaren System. Offenbar sind Wörter und Sätze in einem - und wir fügen jetzt hinzu - autonomen Gedicht etwas Sekundäres, das mit dem Eigentlichen des Gedichts, mit seinem Gehalt und seinem Sinn nichts zu tun hat, oder nur wenig. Also etwas wie die Farben für den Maler; die Mona Lisa ist immer mehr als nur die Verteilung von Farben auf einer Leinwand. Oder hinkt der Vergleich nicht, wie viele Vergleiche?
b) Beim Worte genommen - Arno Schmidt
Arno Schmidt, nicht gerade ein Bewunderer der Weimarer Klassiker, “interpretiert” folgendes Goethe-Gedicht:
Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehn, sich ihrer entladen.
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich preßt,
Und dank ihm, wenn er dich wieder entläßt!
Einmal sogar: <Im Athemholen sind zweyerley Gnaden> Punkt. Nämlich a) <Die Luft einziehn>, (das geht uns natürlich gleichsam noch ab, daß die Finanzämter uns die Luft einziehen!); b) <sich ihrer entladen>, (was'n Ausdruck, bloß um des Reimes willen! Da möchte man sich doch gleich die Wäscheklammer auf die Nase setzen!). Jenes (das Einziehen) bedrängt; dieses (das <Entladen>) erfrischt angeblich - durchaus möglich; obwohl es, mit mindestens derselben Berechtigung, auch umgekehrt lauten könnte: daß nämlich das Einatmen erfrische, (so hab' ich's meist erfunden). Aber eben: <So wunderbar ist das Leben gemischt>; tja, 's iß erschtoanlich; (und am erstaunlichsten noch der ganze, pompös gereimte, ministerielle Schwachsinn!).
Arno Schmidt, Aus julianischen Tagen, S. 210
Wir malen uns nicht aus, was ein Deutschlehrer unter eine solche Interpretation schreiben würde, lassen auch den eher willkürlichen Zusammenhang, in dem diese Gedicht-Sottise steht, außer Acht, und halten nur fest, daß hier einer ein Gedicht gleichsam beim Worte nimmt. Schmidt kümmert sich nicht um Symbolik, Metaphern oder gar Inkommensurables, sondern nimmt die Worte beim Wort und überprüft ihre Berechtigung im Text, ihren “Stellenwert”, um Adornos Begriff zu übernehmen. Und Schmidt macht sich auf “vermschmidtste” Art über das Gedicht des Weimarer Klassikers lustig, ja, decouvriert es als gereimten Schwachsinn. Man muß diesem Urteil nicht folgen und kann doch die unfreiwillige Komik eines “eingezogenen” und “entladenen” Atems nachvollziehen.
2. Zum Sprachskeptizismus
Mit Hofmannsthals Chandos-Brief hält zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Sprachskepsis Einzug in den literarischen Diskurs und steigert sich graduell - unabhängig von eventuellen politischen Positionen, also links und rechts gleichermaßen - zur Klage über einen vermeintlichen Sprachzerfall, der ja nur ein Indiz für den allgemeinen Kulturzerfall sei. Der Untergang des Abendlandes hat von nun an Konjunktur und erfreut sich in eben diesem Abendland zumindest unter einer Gruppe von Intellektuellen ungebrochener Beliebtheit, wenn man auch einräumen muß, daß es besonders günstige (nach den jeweiligen Kriegen) und weniger günstige Zeiten (Zeiten der Vollbeschäftigung und ökonomischen “Stabilität”) für das Armaggedon der europäischen Kultur gab, aber insgesamt hat er, der Untergang, von seiner Leuchtkraft für die Anfälligen nichts eingebüßt.
Der Ausgangspunkt (zumindest was die Literatur angeht) also Hofmannsthal; in dem fiktiven Brief des Lord Chandos an Francis Bacon heißt es u.a.:
Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.
Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte »Geist«, »Seele« oder »Körper« nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament oder was Sie sonst wollen, ein Urtheil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut: sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urtheil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.
zit. nach: http://gutenberg.spiegel.de/buch/997/1
Worin immer die Motivation oder der Grund dieser Sätze liegen mag, ob in einem allgemeinen Dekadenzgefühl, ob in einem biographischen Bruch des Verfassers, der allerdings trotz des Geschmacks von modrigen Pilzen bei der Nennung einiger vor allem abstrakter Begriffe unaufhörlich weiter schrieb, und nicht wenig; ob sie Ausdruck einer inneren Krise der Zeit gewesen sind oder ob sie das Mal einer kulturellen, vielleicht epigonalen Erschöpfung anzulasten sind, mag an dieser Stelle unerörtet bleiben. Festzuhalten ist dagegen, daß diese negative Einstellung zum Arbeitsmaterial einen großen Teil der Dichter nicht mehr verlassen hat. Zeugnis davon legt ein Zitat aus Becketts Endspiel ab, daß diese Sprachskepsis noch weiter verschärft.
HAMM: Yesterday! What does that mean? Yesterday!
CLOV: [Violently.] That means that bloody awful day, long ago, before this bloody awful day. I use the words you taught me. If they don't mean anything any more, teach me others. Or let me be silent.
Bei Beckett ist die Grenze der Sprachskepsis erreicht; wenn die Bedeutungen verloren gehen, dann bleibt nur noch das Schweigen. Das Schweigen ist die ultima ratio der Sprachskepsis und da Beckett sich an dieser Grenze bewegt, ist es nicht verwunderlich, daß er dem Endspiel noch ein Stück anschließt, das den Titel hat: Act without words. Mit dem Schweigen kommt die Poesie, wie alle Literatur zu einem Ende. Wirklich? Bertolt Brecht kommentierte Karl Kraus' Schweigen zur “Machtergreifung” Hitlers als ein Schweigen, das man hört. Vielleicht liegt also im gehörten Schweigen der Zielpunkt der sprachskeptischen Poesie, die mit Hofmannsthal ihren Anfang nahm. Trost, wenn denn Trost nötig sein sollte, findet man in Hans Magnus Enzensbergers ironischem Ratschlag: Auch leere Seiten dürfen gedruckt werden.